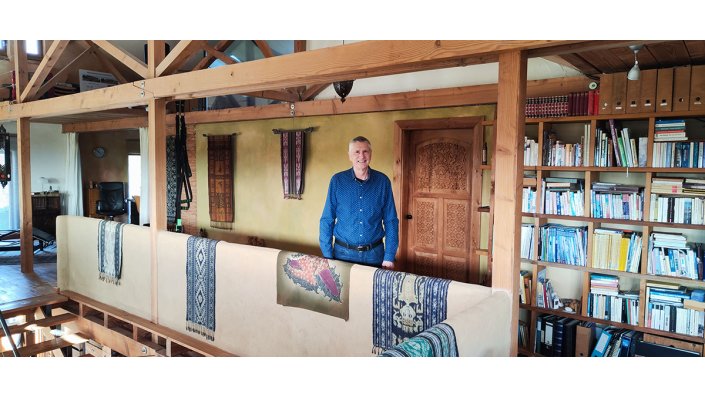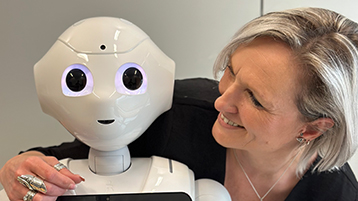Herbert Schmitz: Ein Pionier in nachhaltiger Bauweise weltweit unterwegs

Den Traum vom Reisen mit der Arbeit als Architekt verbinden: Das hat Herbert Schmitz, Absolvent des Studiengangs Architektur und langjähriger Lehrbeauftragter an der Fakultät für Architektur, verwirklichen können. Er hat sich schon sehr früh der nachhaltigen Bauweise verschrieben und war beruflich fast auf der ganzen Welt tätig.
Seine berufliche Laufbahn begann Herbert Schmitz praxisnah mit einer Ausbildung zum Stahlbauschlosser. Bereits im ersten Semester seines Architekturstudiums hatte er ein Schlüsselerlebnis: „Prof. Lukas, der tolle Vorlesungen machte, sprach über den Lehmbau und urteilte, das sei bei uns nicht machbar“. Das wollte Herbert Schmitz nicht einsehen – und hatte das Thema gefunden, das sein gesamtes Berufsleben prägen sollte: das nachhaltige Bauen. Schon im zweiten Semester realisierte er sein erstes Lehmhaus für Freunde, die als Aussteiger in Portugal lebten. Da die Forschung sich in der Zeit kaum mit dem Thema auseinandersetzte, eignete Herbert Schmitz sich sein Wissen durch die praktische Anwendung an, vor allem in Portugal und Marokko, wo diese Bauweise noch angewendet wurde. „Ich war 30 Jahre zu früh dran. Denn was in den 1980er Jahren belächelt wurde, ist heute aktueller denn je“, sagt er lächelnd. Sein Credo: nachhaltiges und kostengünstiges Bauen. „Ich baue mit allem, was da ist und was man nicht kaufen muss“, sagt Herbert Schmitz. So stammt der Lehm, den er für seine Häuser verwendet, in der Regel direkt aus der Baugrube, für die Dämmung verwendet er geeignete Fasern wie Miscanthus (Schilf), Holzfasern, Sägespäne oder Schafwolle. Wird das Gebäude einmal abgebaut, lassen sich diese Materialien ohne aufwändiges Recycling sofort wiederverwenden.
Bildergalerie
 0 / 0
0 / 0
Seminar „Lehmputz" in Äthiopien: Herbert Schmitz zeigt das Aufbereiten, Anmischen und Verputzen von Lehm. (Bild: privat)
 0 / 0
0 / 0
Seminar "nachhaltige Farben“ an der Universität Addis Abeba: Anmischen der Grundfarbe aus Kalk und Herstellen und Aufbringen einer Lasur aus Pigment und Bier (Bild: privat)
 0 / 0
0 / 0
Einweisung in das Seminar "Katalanisches Gewölbe“: Herbert Schmitz mit Studierenden aus Äthiopien und aus Zürich (Bild: privat)
Als die Bauwirtschaft in den 1980er Jahren stagnierte und die Jobaussichten für frischgebackene Architekten wenig vielversprechend waren, belegte Herbert Schmitz noch einige Semester am Institut für Technologie in den Tropen, das heute in der Fakultät für Raumplanung und Infrastruktur aufgegangen ist, und arbeitete nebenher als Reiseleiter. Sein Architekturbüro für umweltgerechtes Gestalten gründete er im Jahr 1989, Mundpropaganda sorgte dafür, dass er als Fachmann für nachhaltiges Bauen schnell gefragt war. Parallel war er von 1991 bis 2006 Lehrbeauftragter am damaligen Fachbereich Architektur, wo er Zusatzfächer in der Denkmalpflege anbot. Hier stand praktische Arbeit im Vordergrund, und Herbert Schmitz war mit seinen Studierenden beispielsweise regelmäßig im Freilichtmuseum Lindlar vor Ort, an dessen Aufbau er beteiligt war. Auch einige Exkursionen mit Studierenden nach Costa Rica, Süd-Marokko und im den Jemen waren Bestandteile der Lehre.
Als die bundeseigene Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ihm anbot, an der Universität Addis Abeba in Äthiopien im „Ethiopian Institute of Architecture, Building Construction and City Development“ den Lehrstuhl „Appropriate Building Technology“ für nachhaltiges Bauen aufzubauen, sagte Herbert Schmitz sofort zu. Äthiopien ist eines der ärmsten Länder überhaupt, ein Weg aus der Armut sollte die Bildung sein. Herbert Schmitz zog in die Hauptstadt Addis Abeba, erarbeitete Lehrpläne und Vorlesungen, aß wöchentlich mit Ministern zu Mittag und sah seine Heimat nur im Urlaub. Nach fast fünf Jahren mit einem harten Alltag in einem bitterarmen Land wollte er, der Gesundheit zur Liebe, wieder nach Hause und übergab den Lehrstuhl seinem äthiopischen Nachfolger.
Neben der Tätigkeit im eigenen Architekturbüro nahm er seitdem immer wieder spannende Projekte im Ausland an, so zum Beispiel in Usbekistan und Kirgisien, wo er nachhaltige Gebäude für die Trocknung von Obst und Gemüse baute, im Kosovo, in Sierra Leone und Indien. Schon in den 1990er Jahren hatte er in Costa Rica eine Forschungsstation aufgebaut. Eine besondere Beziehung hat Herbert Schmitz zu Asien: In Kambodscha war er lange Jahre Partner beim Projekt zur Erhaltung der Reliefs am Angkor Wat, Weltkulturerbe und größte Tempelanlage der Welt, das von Prof. Dr. Hans Leisen vom Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft geleitet wird. „Ich bin von der zupackenden Mentalität in Asien begeistert – Projekte werden viel weniger durch Bürokratie und Bedenken verhindert als bei uns. Hier macht es zum Teil keinen Spaß mehr“, sagt Herbert Schmitz. Heute nimmt er nur noch Aufträge an, die ihn besonders reizen. „Australien ist der einzige Kontinent, auf dem ich noch nicht gearbeitet habe – vielleicht ergibt es sich ja noch“, sagt Herbert Schmitz lächelnd. Angesichts seines Tatendrangs ist es gut vorstellbar, dass er dieses Ziel auch dann noch ansteuert, wenn andere Menschen in seinem Alter bereits die Rente genießen.
März 2025